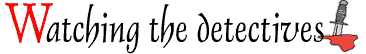News & Texte & Kolumnen
Aktuell 20635Einträge
Zeichnungen & Fotos
Altlasten aus 15 Jahren
Krimilinks
Hier
wtd - die Zeitschrift
→Übersichtsseite
Aktuelle Ausgabe:
→ wtd 4: PDF
→wtd 4: DOC.
*******
Rezensionen 2006
Rezensionen 2005
Die lachenden Detektive
*******
DIE GLORREICHEN SIEBEN:
Favoriten 2009
John Harvey: Tiefer Schnitt
Uta-Maria Heim: Wespennest
Christian Pernath: Ein Morgen wie jeder andere
Vamba Sherif: Geheimauftrag in Wologizi
Andrea Maria Schenkel: Bunker
Rex Miller: Im Blutrausch
Monika Geier: Die Herzen aller Mädchen
*******
Krimischaffen
Wir lernen Computer
Dort
Criminalbibliothek
Krimikultur Archiv
Martin Compart
Krimi-Depeschen
Le Véro
Bernd Kochanowski
Europolar
Axel Bussmer
Propellerinsel
Krimiblog
Ingeborg Sperl
Text und Web
Kaliber 38
Krimilady
Frauenkrimis
Krimikiste
Notizen und Texte
Astrid Paprotta
Krimi-Couch
Krimizeit
Krimi.Krimi
Jan Seghers
Georg
Crime Time
Crime Culture
Krimisalon Tübingen
Jürgen Albertsen
Saarkrimi
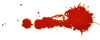
Hinternet durchsuchen:
Monatsarchive:
Rubriken
Die aktuellsten Kommentare
• Kle: ach. Dann hat ja das Gratisangebot ab morgen auch keinen Sinn mehr, wäre schofelig danach zu fragen,
(mehr...)
• Ria: Auch wenn du nächstes Jahr die Krimikritik-Diktatorenschaft nicht an dich reißen kannst, weil da der
(mehr...)
• Ria: Klingt wie der Titel eines epischen Dramas:
'Der mit den Eiern tanzt'
(mehr...)
• dpr: Liebe LeserInnen, wenn das der letzte Beitrag von wtd ist, den ihr sehen könnt, dann müsst ihr <a hr
(mehr...)
• dpr: Kann man machen. Ist aber problematisch, wenn man zuerst die Abbdruckgenehmigung praktisch aufdrängt
(mehr...)
• Kle: "Nie hätte ich gedacht, dass sich die Rechte an einem Cover an die Lieferbarkeit eines Titels knüpfe
(mehr...)
• Peter J. Kraus: Egal, was Rowohlt mag oder nicht mag: ich erkläre hiermit meine Titelabbildungen zu beliebig verwend
(mehr...)
• Ria: Aber die Frage war doch, was musst du tun, um als Krimiautor mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.
Mag sc
(mehr...)
• dpr: Hm, Ria, das ist jetzt aber arg feuilletonistisch... Sollten wir den bösen Bubis nicht Fingerchen ma
(mehr...)
• Ria: Wir machen Folgendes:
Ein Buch, in dem wir messerscharf nachweisen, dass die Feuilletonisten uns gei
(mehr...)
Sprachbunker. Vorbereitungen einer Lektüre
Sprache spielt, seien wir ehrlich, in vielen Kriminalromanen keine besondere Rolle. Man brütet über Plot und Spannungsbogen, Personenzeichnung und dem Unterschied zwischen einer Pistole und einem Revolver, die Sprache indes bleibt eben die Sprache, so wie der Löffel, mit dem der Koch die delikate Suppe kostet, halt der Löffel ist. Knackig soll Sprache sein, eingängig, "gut", einigermaßen dudenkonform. Was nun "gute Sprache" sei, weiß kein Mensch, das heißt: alle wissen es. Sie soll den Inhalt "rüberbringen" und unseren nebulösen Vorstellungen von Cooltour - Kultur entsprechen. Dass die Sprache Inhalt sein könnte, also Teile der Geschichte erzählen, die in dieser ausgespart bleiben, hat sich als Erkenntnis höchstens bei den happy few festgesetzt, die tatsächlich darauf pochen, Sprache sei die geheime Hauptperson in einem Text. Wer als Autor / Autorin damit arbeitet, hat mindestens ein Problem. Andrea Maria Schenkel hat viele.
Denn Andrea Maria Schenkel arbeitet mit Sprache. Und zwar so, dass wir annehmen können, sie nehme die oben skizzierte mögliche Funktion, in die Sprache wesentliche Teile des Erzählten auszulagern, ernst. Ob ihr das mit "Bunker" gelungen ist? Das soll uns an dieser Stelle gar nicht interessieren. Die Sprache interessiert uns. Warum ist sie in "Bunker" so und nicht anders gewählt? Wie verändert sie unsere Wahrnehmung des Erzählten? Was fügt sie hinzu? In welche Richtung lenkt sie?
Ich habe mir die Mühe gemacht, einen Teil der bislang vorliegenden Rezensionen hinsichtlich der Berücksichtigung von Sprachwahl und Rededuktus zu durchforsten (Grundlage waren die Notierungen bei den "Alligatorpapieren"). Nicht überall ist das überhaupt ein Thema. Wir erfahren wohl, dass in "Bunker" zwei Menschen in der ersten Person Singular Präsens denken / schreiben / beschrieben werden (auf diese Trinität kommen wir gleich zurück, sie ist, salopp gesagt, der Knackpunkt), unterbrochen von zumeist kurzen, distanzierten Betrachtungen, die den Ausgang der Erzählung kryptisch vorwegnehmen. Dieser stete "Wechsel der Erzählperspektive zwischen dem Entführer und der Entführten (wird) durch unterschiedliche Schrifttypen kenntlich gemacht. Nicht ganz neu, aber in ihrem dramatischen Effekt sehr wirkungsvoll", stellt →Hendrik Werner in seiner Besprechung richtig fest. Für →Hannes Hintermeier "sprachlich ein ausgetretener Hausschuh", für →Ulrich Noller "ein erstaunlich experimenteller Versuch", wenigstens Teil eines solchen.
Zwei Protagonisten, die "ich" sagen – und das im Präsens. So etwas nennt man, weiß →Burkhard Müller, "die erlebte Rede". Die aber sei nun einmal "die geschwätzigste aller literarischen Darbietungsweisen". Sie habe "keine Wahl, als getreulich alles zu registrieren, was dem Betreffenden so durch den Kopf schießt."
Wo es "erlebte Rede" gibt, müsste es auch eine Art "nicht erlebter Rede" geben, und die gibt es tatsächlich. "Nicht erlebte" oder, genauer, im Nachhinein rekonstruierte Rede kann nur die sein, die vom Autor bearbeitet wurde. Eine Person denkt etwas, der Autor formuliert es zurecht. Stellen Sie sich etwa vor, Sie überqueren eine Straße und bemerken im Augenwinkel, wie ein Auto in hoher Geschwindigkeit auf Sie zu rast. Was denken Sie "spontan"? Wahrscheinlich nicht viel, und schon gar nicht in vollständigen Sätzen. Sie machen sich so schnell es geht vom Acker. Nehmen wir an, Sie dächten "wassn das --- Mensch, Scheiße --- ah ---" oder ähnliches. Das könnte nun der Autor, dem es auf "erlebte Rede" ankommt, so hinschreiben. Die wenigsten würden das tun. Statt dessen würde daraus wohl so etwas wie "Von links plötzlich ein rotes Auto. Scheiße! Ich nehme die Beine in die Hand und... pp". Das wäre eine Form von " nicht erlebter Rede", zwischen dem Moment des Geschehens und seiner schriftlichen Wiedergabe liegt unzweifelhaft eine Periode der Bearbeitung. Die meisten von uns würde etwas daran stören: die Gegenwartsform. Zu recht. Denn das Präsens suggeriert eben den synchronen Ablauf von Erleben und Erzählen. Und kein Mensch würde glauben, ein soeben von einem Auto Bedrohter käme im Wortsinn auf den Gedanken, "seine Beine in die Hand zu nehmen".
Also würden die meisten Autoren das Ganze in die Vergangenheitsform stecken: "Von links plötzlich ein rotes Auto. Scheiße! Ich nahm die Beine in die Hand und pp." Das wäre zu akzeptieren – aber kein "gutes Deutsch". Der erste Satz ist elliptisch, ihm fehlt etwas. Besser wäre also "Von links raste plötzlich ein rotes Auto auf mich zu" – und weil "rasen" ja relativ ist und der Leser es immer genau wissen muss, würde der Normalautor wohl noch ein "mit hoher Geschwindigkeit" oder "mit mindestens 80 Sachen" einfügen.
Die spannende Frage nun: Wie hält es eigentlich Andrea Maria Schenkel mit der mehr oder weniger erlebten oder künstlerisch bearbeiteten Rede? Das scheint von allen RezensentInnen, denen ich auf die Finger geschaut habe nur einen genauer zu interessieren, →Thomas Klingenmeier nämlich. Er beginnt: "Schenkel lässt Täter und Opfer nicht nur in der ersten Person, sondern auch noch im Präsens berichten. Das ist die heikelste Perspektive überhaupt, und die Autorin scheitert mustergültig." Dass es die heikelste Perspektive ist, aber nicht, wie es Burkard Müller glaubt, weil sie etwas mit "Geschwätzigkeit" zu tun habe, dazu gleich mehr. Klingenmeier fährt nun aber fort: "Mal scheinen wir uns einen Halbsatz lang in einem Bewusstseinsstrom zu befinden, eingeklinkt ins direkte Erleben. Dann scheint doch alles trocken gewählt erzählt, als berichte die erlebende Figur aus dem Nachhinein, nutze aber das Präsens zwecks vermeintlich druckvoller Erinnerungsvermittlung."
Was damit gemeint ist, soll mit einer kleinen Passage aus "Bunker" verdeutlicht werden:
"Was ist das für ein Geräusch? Ist da einer an der Tür? Quatsch, wer sollte das sein. Der Fettsack ist tot. Aber einer macht sich an der Tür zu schaffen. Nein, nein! Verdammt, da ist einer. Sie kann es nicht sein! Wer ist da! Scheiße, Scheiße! Alles geht schief! Wer kann das sein? Jetzt bloß kein Quietschen an der Tür, bitte kein Quietschen!"
(Diese Passage von S. 6 ist deshalb interessant, weil man das Erinnerungsmoment in dieser konstruierten "erlebten Rede" noch gar nicht erkennen kann).
Kein Zweifel: Klingenmeiers Analyse ist zutreffend. Ganz offensichtlich haben wir hier ein Gemisch aus "direktem Erleben" und im Nachhinein formulierter Erinnerung. Wozu das? Grundsätzlich: Es hat in der gesamten Literaturgeschichte noch nie jemanden gegeben, dem es gelungen wäre, "authentische Bewusstseinsströme" getreulich aufzuschreiben. Und wäre es jemandem gelungen, so wäre dieser Jemand kein AUTOR, sondern ein schlichter Aufschreiber – und gleichzeitig eines der größten Genies. Autoren nämlich haben es so an sich, ihren Stoff künstlerisch zu bearbeiten. Wenn sie also "Bewusstseinsströme" suggerieren, dann allenfalls, um den Unterschied zwischen Gedachtem und Geschriebenem mit all seinen Metamorphosen und wilden Assoziationsclustern aufzuzeigen und, ganz wichtig, als Erzählmittel einzusetzen. Der vielleicht berühmteste "Innere Monolog" der Weltliteratur, Molly Blooms Gedankenraserei in James Joyces "Ulysses", ist nicht das Werk eines " geschwätzigen Aufschreibers", sondern eines Künstlers. Eines Künstlers, der WEISS, dass Denken nicht Sprechen ist. Es mag Menschen geben, die druckreif sprechen können; einen Menschen, der druckreif denkt, gibt es außerhalb psychiatrischer Anstalten (?) – hoffentlich – nicht. Wenn wir das aussprechen, was wir denken, fungieren wir gleichsam als eine "ordnungschaffende Distanz", die auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner kommuniziert: der GESPROCHENEN Sprache.
Wir wollen dieses unerschöpfliche Thema an dieser Stelle nicht überstrapazieren. Nur: Dass die erlebte Rede "keine Wahl (habe), als getreulich alles zu registrieren, was dem Betreffenden so durch den Kopf schießt", wie es Burkhard Müller fordert, kann ausgeschlossen werden. Schon deshalb, weil "erlebte Rede" bereits eine bearbeitete Form dessen sein muss, was uns durch den Kopf geschossen kommt und zufälligerweise keine Pistolenkugel ist.
Zurück zu Thomas Klingenmeier. Er hat erkannt, dass in "Bunker" wenigstens Arten von Bearbeitung stattfinden. Diejenige, die vorgibt, einen "Bewußtseinsstrom" zu notieren und diejenige, die aus der Distanz des Sicherinnerns die Gedanken zurecht formuliert. Sie unterscheiden sich wesentlich durch Syntax und Wortwahl. Man könnte das, wie es Hannes Hintermeier tut, als "Figurenrede" identifizieren, als eine Art des Schreibens, die vom Autor erwartet, seinen künstlerischen Anteil um den nicht unerheblichen Part des Sprachschöpfers zu reduzieren. Denn WIE hier gesprochen wird, ist Aufgabe der Figur. Und sie entzieht sich den literarisch-kritischen Kriterien. Wenn die Figur nicht weiß, was indirekte Rede ist – dann weiß sie es eben nicht. Die Autorin trifft also keine Schuld. Wenn die Figur schiefe Bilder und Metaphern verwendet – und davon gibt es in "Bunker" reichlich, dann verwendet sie die eben – und NICHT die Autorin.
Dieses Phänomen tritt grundsätzlich beim Ich-Erzählen auf. Es mag hier und da eine Ausrede des Autors sein, mit der er entsprechende Kritik milde grinsend abschmettern kann. Aber es ist dennoch so. Ich möchte z.B. keine Vierzehnjährige sagen hören: "Ich bin mir der Ungeheuerlichkeit meiner Behauptung, Herr Müller sei ein Scheusal, zur Gänze bewusst". So kann ein Autor in einer Erzählung, die aus der auktorialen Position (Er / Sie) formuliert, schreiben – wiewohl auch dann zu fragen wäre, was für eine komische Vierzehnjährige er da im 21. Jahrhundert aufgetan hat (dennoch könnte es gute Gründe dafür geben...).
Kommen wir zu einem letzten Aspekt: In "Bunker" bedienen sich ZWEI Protagonisten der Ich-Form. "Zwei äußerlich kaum konturierte Ich-Stimmen", konstatiert →Tobias Gohlis, und das mag sich eben nicht nur auf die Tiefe der Personenzeichnung beziehen. Der Krimicouch-Leser →SukRam bringt es auf den Punkt: "Täter und Opfer unterscheiden sich in ihrer Rede nur durch die Schriftart. Keine sprachlichen Unterschiede."
Keine sprachlichen Unterschiede. Die müsste es aber geben, oder? Hier eine Frau, dort ein Mann. Hier das Opfer, dort der Täter. Beide haben Stress, natürlich, aber unterscheidet sich der eine nicht vom anderen? Sind beide von so verblüffend ähnlichem Naturell, dass sie weder in Wortwahl, Grammatik und Diktion wirklich zwei genau differenzierbare Personen repräsentieren?
Aber wir wollen hier ja nicht urteilen. Wir wollen ergründen, ob Andrea Maria Schenkel mit der Sprachwahl den Inhalt / Gehalt des Textes steuert. Und ich denke schon, dass sie das tut. Zumindestens legt sie die Grundlagen dafür.
Kurz zusammengefasst: Mit der Entscheidung für das Ich in der Gegenwartsform, welches Elemente der erlebten mit der erinnerten Rede kombiniert, verweist die Autorin auf entsprechende Korrelationen innerhalb der Handlung. Beides, Gegenwart und Vergangenheit, gehört irgendwie zusammen – wie, das muss die Lektüre ergeben. Sprachlich ist der Text so gehalten, als sei er kein "Autorentext", d.h. Schenkel imitiert in der Unzulänglichkeit von Stil, Grammatik und Wortschatz eine ganz bestimmte Denk- und Argumentationsweise, ja, auch den Bildungsstand ihrer Ich-Personen. Und drittens: Die Personen sind, da sprachlich kaum voneinander abgegrenzt, im Grunde EINE Person, Opfer- und Täterrolle KÖNNTEN etwa ständig wechseln. Das sieht auch →Volker Albers so: "Der Wechsel der Erzählperspektive, der die Eindeutigkeit der Täter- und Opferrolle offenbar relativieren soll (...)".
Die "Abwesenheit" der Autorin / Schöpferin führt dazu, dass - noch einmal Hannes Hintermeier - "Opfer wie Täter (...) ohne Empathie von Seiten ihrer Autorin auskommen" müssen (wobei, siehe oben, überhaupt zu fragen wäre, wer hier Opfer, wer Täter ist).
All das, was hier zusammengetragen wurde, entscheidet nicht darüber, ob es sich bei "Bunker" um einen gelungenen oder misslungenen Text handelt. Es besagt lediglich: Schon bevor wir uns mit dem Gehalt des Textes selbst beschäftigen, wissen wir, dass wir das ohne Berücksichtigung der Sprache nicht können. Und wir sollten, wenn wir uns mit dieser Sprache beschäftigen, wohlweislich Abstand halten von dem, was uns die Konventionen eingebläut haben, also "gutes Deutsch ist...", "erlebte Rede ist...", "Figurenzeichnung ist...". Ganz offensichtlich transportiert die Sprache in "Bunker" nicht nur Inhalte – sie IST Inhalt. Und das Experiment gelingt – oder es misslingt – oder ist letztlich nichts weiter als ein Pseudoexperiment.
So. Und jetzt können wir lesen.
dpr
6. April 2009
* * *
↑ Weblog-Index
← CD-Kritik:
The Whitest Boy Alive: Rules
→ Wissenswertes über...:
Kaspars Bruder